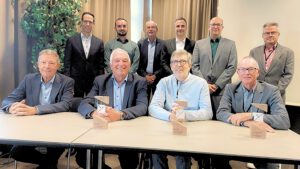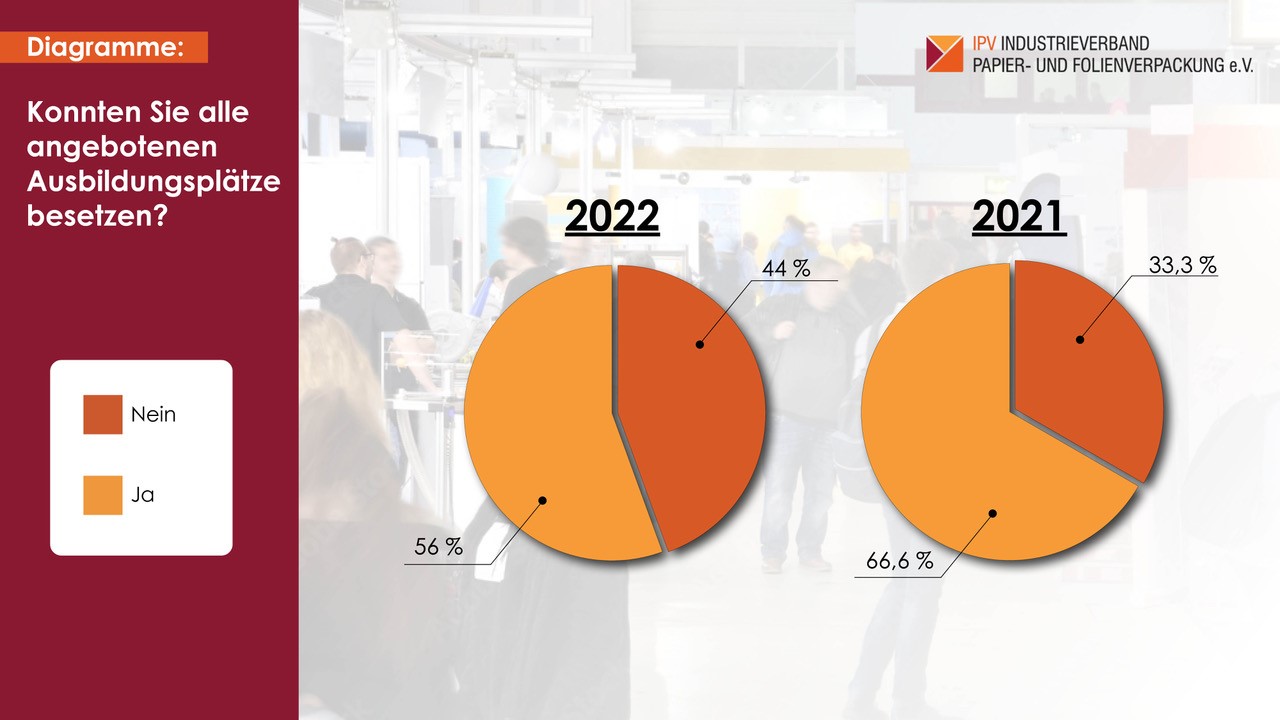IPV-Mitgliederversammlung: Neuer Ehrenvorstand ernannt – Politische Entscheidungen und Umsatzrückgang belasten die Branche nachdrücklich
(Trier/Deutschland). Die Mitgliederversammlung des Industrieverbands Papier- und Folienverpackungen (IPV) in Trier war ausgesprochen gut besucht. Vorstandssprecher Jens Vonderheid und Geschäftsführer Karsten Hunger konnten zahlreiche Vertreter der Mitgliedsunternehmen begrüßen – wohl auch, weil sich die Branche weiterhin großen Herausforderungen ausgesetzt sieht. Nicht nur die verschärfte Herstellerverantwortung (Litteringabgabe) im Rahmen der Einwegkunststoffrichtlinie, sondern auch die neuen Sorgfaltspflichten der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) sowie das Dauerthema PPWR bereiten den Unternehmen erhebliche Schwierigkeiten. Diese Regelungen, die zahlreichen ungeklärten oder strittigen Fragen dazu sowie die damit einhergehende Unsicherheit in der gesamten Lieferkette erschweren die Arbeit und bremsen die gesamte Branche aus. Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer noch immer extrem bürokratischen Politik sind folglich auch für die IPV-Mitgliedsunternehmen deutlich spürbar. Die Zahlen belegen das: Mit 17,1 Millionen Tonnen sank die Menge der produzierten Packmittel 2024 um 2,4 Prozent. Der Umsatz der Packmittelproduktion fiel um 4,1 Prozent auf aktuell 37,1 Milliarden Euro. Der Rückgang zeigte sich über alle Verpackungsmaterialien hinweg ähnlich. Karsten Hunger fand dazu deutliche Worte: „Es macht den Anschein, als ob Gesetzesvorhaben und Umsetzungen von EU-Verordnungen nicht dem Motto ‚Qualität vor Schnelligkeit‘ folgen. Das zieht schwerwiegende Konsequenzen für die Wirtschaftslage nach sich. Aus unserer Sicht braucht es für neue, sinnvolle und umsetzbare nationale sowie europäische Gesetzesvorgaben vor allem Sorgfalt und Zeit bei der Erstellung. Bei jedem Gesetz sollte eine faktenbasierte Folgenabschätzung im Vorfeld mitgedacht werden.“ Aus Sicht des IPV darf es nicht sein, dass neue Gesetze regelmäßig vor Gericht landen, überprüft und anschließend häufig geändert werden müssen. Schon seit Längerem fordert der Verband, dass für jede neue Verordnung zwei alte gestrichen werden müssen. Die extremen Belastungen durch die Bürokratie sind eine echte Wachstumsbremse für die Unternehmen.
Vorstand bestätigt und erweitert
Wie wichtig die Verbandsarbeit ist, zeigte sich im Jahresbericht und fand auch bei den Vorstandswahlen Anerkennung. Denn neben der Bestätigung der bisherigen Vertreter Jens Vonderheid (Sprecher), Mike Hartung (Schatzmeister), Carsten Gütt, Rüdiger Hellwig und Harald Schäfer (kooptiert) wurde Robert Beregowez neu in den Vorstand gewählt. Damit wurde das Gremium weiter gestärkt. Beruflich ist Robert Beregowez als Senior Manager Recycling & Sustainability bei der Papier-Mettler KG tätig, dem europäischen Marktführer im Bereich Serviceverpackungen aus Papier und Kunststoff.
Der IPV steht in enger Abstimmung mit den anderen Fachverbänden. Um gemeinsam den Einfluss auf Politik und Gesetzgebung zu stärken, haben sich in Frankfurt mehrere Verbände der Papier- und Kartonverarbeitung in diesem Jahr zu einer starken Bürogemeinschaft zusammengeschlossen. Seit Sommer befindet sich die gemeinsame Zentrale in der Kleinen Hochstraße – zusammen mit dem Fachverband Faltschachtel-Industrie (FFI), der European Core and Tube Association (ECTA), der Gemeinschaft Papiersackindustrie (GemPSI), der Fachvereinigung Hartpapierwaren und Rundgefäße (FHR) sowie dem Arbeitskreis Display arbeitet der IPV nun von dieser neuen Adresse aus. IPV-Geschäftsführer Karsten Hunger erklärt: „Bei den vielen verbändeübergreifenden Meetings wurde immer wieder deutlich, dass die Verbände der Verpackungsbranche oftmals dieselben oder ähnliche Themen und Herausforderungen bearbeiten müssen. Da lag es nahe, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Und wenn die Verbände ohnehin in Frankfurt ihren Sitz haben – warum dann nicht unter einem Dach? Das gewährleistet eine unkomplizierte Zusammenarbeit und eine rasche Kommunikation.“
Wahl von Ehrenvorständen und Verabschiedung von Thomas Pfeiffer (WPV)
Die diesjährige IPV-Mitgliederversammlung stand auch im Zeichen besonderer Ehrungen: Drei langjährige Vorstandsmitglieder wurden unter großem Beifall zu Ehrenvorständen ernannt – Klaus Jahn, Hagen Puttrich und Karl-Heinz Hoffmann. Die Würdigung übernahm der ehemalige IPV-Geschäftsführer Bernhard Sprockamp: „Klaus Jahn war seiner Zeit stets voraus und für den IPV ein Glücksfall. Er erkannte Probleme frühzeitig und packte sie entschlossen an. Hagen Puttrich war als Schatzmeister eine Stütze und Bereicherung für den Verband mit einer hervorragenden Vernetzung. Und unter der Leitung von Karl-Heinz Hoffmann blühte der Technische Ausschuss in Qualität und Servicetiefe regelrecht auf. Alle drei haben Herausragendes für den IPV geleistet.“ Auf der Mitgliederversammlung 2025 gab es abschließend auch eine besondere Verabschiedung. Der Verband verabschiedete den WPV-Geschäftsführer Thomas Pfeiffer in den wohlverdienten Ruhestand. Der Verband dankte ihm herzlich für sein langjähriges Engagement und die sehr gute Zusammenarbeit. In all den vielen Jahren der Zusammenarbeit schaffte er es, die Interessen der Unternehmen der flexiblen Verpackungen gegenüber Politik und Ministerien klar und deutlich zu vertreten.
„Auf der Mitgliederversammlung des IPV wurde der Vorstand bestätigt und erweitert. Zudem wurden mit Klaus Jahn, Hagen Puttrich und Karl-Heinz Hoffmann einstimmig drei Ehrenvorstände gewählt.“